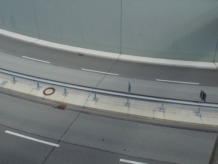Die Mentalität des Militarismus
Alain's “Psychologie des Krieges” von 1921
Alain oder Emile Auguste Chartier bedient sich in nicht geringem Maß der althergebrachten Mittel inhaltsarmer Rhetorik und quasi theologisch vorgetragener Gemeinplätze.
Das ist der von ihm geübten Gattung des 'propos', der Zeitungskolumne in der Art eines thematischen Kurzkapitels zu verdanken. Unverständliche Passagen dienten darin wohl als Seitenfüller ...
Der Duktus des inzwischen hundert Jahre alten Textes wirkt altmodisch, aber immer noch anregend und soll angeblich in freier Rede bzw. Denken entstanden sein.
Daher besteht der größere Teil dieser Philosophie aus ziemlich wahllos aneinandergereihten Einfällen.
Alains Sprache ist nicht zielführend; man muss seine Gedanken erst finden, selbst herausarbeiten und dann neu formulieren!
Man kann sich auch nie ganz sicher sein, woran man ist bei Emile Auguste Chartier: Einmal beschreibt er die Militärparade als Inbegriff des Schönen. Sehr viel später regt er an, dass Krieg "ästhetischen Emotionen" entspringen könnte, die infolge ihrer militärisch-industriellen Hässlichkeit nur durch ihre Monopolisierung durchgesetzt werden konnten [Alain 1921, 89)].
Er war jahrelang als Freiwilliger bei den Kanonieren, das hat seiner mentalen Gesundheit sicher nicht gut getan. Der Militärapparat des 1. Weltkrieges war die Verkörperung der letzten Dinge - von der Etappe bis zum Frontbereich ...
Alain liefert am Anfang dieser Sammlung keine wirkliche Hilfestellung gegen den Militarismus, sondern fügt sich in seinen Mechanismus ein. Allerdings vollzieht er schon nach wenigen Propos nicht nur einmal die 180°- Kehrtwende.
"Wer den Krieg will, ist mit sich selber im Krieg." [Alain 1921, 22)]
Diejenigen, die den Krieg von Angreifern abwehren müssen, wollen natürlich keinen Krieg. Aber man muss deutlich machen, dass Alain in diesem relativ inhalts- und umfangreichen Text eigentlich den Verteidigungskrieg Frankreichs in Zweifel zieht. Dieser Tatbestand wird nur dadurch abgemildert, dass er erst nach dem Sieg über Deutschland geschrieben wurde und nachdem sein Autor Freiwilligeneinsatz und Kriegsverletzung durchgestanden hatte.
Sicher hatte er sich mehr aus journalistischem Interesse als aus Patriotismus in relativ fortgeschrittenem Alter als Freiwilliger gemeldet.
Auch dieser Autor versuchte noch, einen Mythos zusammenzustricken vom "Werk des Starken, das immer ein Werk der Gerechtigkeit, des Schutzes, der Besserung ist" [Alain 1921, 79)].
Dieselbe positive Kraft wäre natürlich der Interventionskrieg des Starken im Gegensatz zum hinterlistigen Krieg des Schwachen.
Die Taten eines Heros seien vollkommen anders geartet als die Taten willenloser und ohnmächtiger Soldaten.
Aber er stellt bereits die neue Klassenlehre unter Missachtung von Adel und Klerus auf. Er unterteilt die Menschen in diejenigen, deren Aufgabe die "Ordnung der Dinge" sei, unhöflich und nachlässig gekleidet, und in diejenigen, deren Aufgabe die "Ordnung der Menschen" sei, höflich und gut gekleidet. [Alain 1921, 39)]
Dieses hundert Jahre alte kleine Büchlein bietet auch eine kleine Reminiszenz an die untergegangene Funktion der Demokratie, der breiten Bevölkerung Recht gegenüber den "Gewalten" (König, Klerus, Militär) zu verschaffen [Alain 1921, 42)].
Leider musste das damals wie heute vor allem durch Beschreibung des Systems der Repression geschehen. Doch wie soll man gegen diese Kräfte vorgehen?
Die Praxis des Krieges
Alains Psychologie enthält selbst Tips vom Landser, wie man siegt: nur das Unmögliche ("uneinnehmbare Stellungen stürmen und unhaltbare Stellungen halten") bringe den Erfolg [Alain 1921, 13)].
Doch alle Kriegsereignisse seien "unvorhersehbar" und "durch das Überwiegen zufälliger Ursachen" im Wesentlichen "anekdotisch".
Alain äußert ernsthafte Zweifel an "Utopien über eine allein kraft Brüderlichkeit und anerkanntem Sachverstand der Befehlenden handelnden Armee".
Denn Kriege bewegen sich unterhalb jeden moralischen Urteils.
Ohne drakonische Strafen (gemeint wird vom Autor explizit die Todesstrafe) "würden die Truppen bald dahinschmelzen und wie Wasser in der Erde versickern"; "der Soldat muß, außerhalb des Kampfesglücks, jeglicher Hoffnung beraubt werden" [Alain 1921, 10)].
Im Krieg sind die "materiellen Mittel", insbesondere Waffen und Verproviantierung allein ausschlaggebend, nicht die Rechte und Ideale der Betroffenen.
Der Krieg ist also Instrument und nicht nur "Symbol des triumphierenden Materialismus". [Alain 1921, 11)]
Gewinnsucht sei kein kleinliches Gefühl, sondern "eine Gewalt, die einer Gewalt ... antwortet".
Gewinnsucht gehört zum Führen eines Krieges, selbst eines Verteidigungskrieges ...
Ursachen von Krieg
"Ich schließe, daß es im Hinblick auf den Krieg zwei entscheidende und gleicherweise gefährliche Irrtümer gibt: Der eine hält ihn für unvermeidlich und der andere für unmöglich."
Es ist sehr unerfreulich, feststellen zu müssen, dass sich niemand “versklaven” lassen will durch I d e e n wie ‘Gerechtigkeit und Wahrheit’, statt dessen aber alle offenbar gerne die F a k t e n der Gewalt akzeptieren.
Sind Kriege und Steuerabgaben sinngebend, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass erstere die letzteren vollständig zu verschlingen pflegen?
>> Ist Krieg eine nach "unausweichlichem Gesetz" sich in der Geschichte periodisch wiederholende Katastrophe?
>> Bricht er "gegen menschlichen Willen", trotz Vorhersage, Vorsichtsmaßnahmen und Kriegsangst aus?
>> Dient er der Anbetung von Titanenwerk und Menschenkraft?
>> Oder lassen sich durch ihn "Machtbesessene" in hoher und niedriger Position "zu Königen küren"?
[Alain 1921, 89)]
Leidenschaften als Ursache
Krieg werde durch Krieg genährt wie Zorn durch den Zorn.
Und: "Das Furchtbare in den Leidenschaften ist, dass sie stets durch Tatsachen gerechtfertigt sind." [Alain 1921, 2)]
Alain wendet sich gegen Theorien, "die alle unsere Handlungen mit einem mehr oder weniger verschleierten Interesse erklären" [Alain 1921, 20)].
Alain vermutet einen Impuls, aus Liebe zu töten und sogar das zu töten, was man liebt, wobei der eigentliche Impuls aber die Eifersucht ist.
Oder ist es vielleicht die Fresssucht? Niemand kann ein Interesse an Kriegen haben, selbst hungrige Kannibalen nicht.
Auch Erich Fromm hat ja die Leidenschaften als Faktor der Destruktivität von den Instinkten abgesondert.
Alle Leidenschaften und die Angst kulminieren im Zorn. Die durch sie ausgelösten Irritationen führen zu unkontrollierbaren Handlungen.
Das Kind schreie immer weiter, weil es durch sein eigenes Schreien irritiert sei. [Alain 1921, 20)]
Als Gegenmittel wird man die Rationalität empfehlen. Diese wird allerdings überaus häufig ebenfalls von Leidenschaften und Angst gespeist und kann nach Erich Fromm sogar zur Ursache der größten Destruktivität und Perversion werden.
"Ich sehe, wie viele Leute sich in gewalttätigen Worten vereinen, obwohl ihre wirklichen Leidenschaften ganz verschieden sind."
Leidenschaft und Fanatismus werden nicht durch rationale Überlegungen am Leben erhalten, sondern sie werden eine psychische Konstante, die aber offensichtlich gewisser Schlagworte und Aktionen bedarf, um weiterzuglimmen.
Gewalttätige Leidenschaften könnten trotzdem reale Ursachen haben ...
Die Ursachen könnten eine bittere Erniedrigung oder Fremdherrschaft sein oder auch die Herrschaft fremdartiger Wertvorstellungen.
Die Ursache könnte aber auch in übersteigertem Narzissmus liegen.
Militärärzte nahmen nach Alains Ansicht an den Soldaten dafür Rache, dass sie "vor so vielen Patienten ... katzbuckeln" mussten.
Am gefährlichsten ist aber die politische Macht der Leidenschaften. Dass nämlich jede faschistische Willkür auch von einer unerklärlichen, "gefährlichen und berauschenden Begeisterung" getragen wird [Alain 1921, 68)].
Hier muss man den Zusammenhang mit einer Leidenschaft zur Mentalität offenlegen, die mit Volkstum, Tradition und den gesellschaftlichen Verhältnissen begründet wird, denn Mentalität ist selbst die Affinität oder Leidenschaft zu einer größeren Population.
Der Krieg im Denken
Offenbar ist Denken das menschliche Leiden.
Angesichts der Opfer sollte man seine "tödlichen Maximen" mehrfach überdenken.
".. vom klassischen Unterricht" wurden "durch die Botschaft der Dichter und Denker aller Zeiten traditionelle Formeln der Theokratie übermittelt" [Alain 1921, 40)].
Nur die proletarische Schulbildung besitze ein gewisses Rüstzeug für die praktische Wirklichkeit.
Der Proletarier "hängt von Subalternen ab, welche die Zeit messen und die Arbeitsprodukte zählen" [Alain 1921, 40)].
Daher bringe er kein Verständnis für die Überlieferungen bedeutender Menschen auf, zu welchen leider auch die Zirkelschlüsse der imperialen Staats- und Kriegskunst gehören.
(Proletarische Bildung mag aber zur Entwicklung der tödlichsten Waffen verholfen haben!)
Krieg sei nicht mit Raufereien zu verwechseln.
Denn das "maßlose Verbrechen", Menschenmassen aufeinander zu hetzen, findet in der Sphäre des Geistes statt! [Alain 1921, 90)]
Es bedürfe der Doktrinen, der Ideale und schließlich der Moral und der Religion, um den Geist der Wut unterzuordnen.
Vor allem bedürfe es aber der Wissenschaftler und Philosophen, um eine "Krone falscher Gründe" für den Krieg zu schmieden.
Nur durch "den zustimmenden Geist" kommt es zum Krieg.
[Alain 1921, 90)]
Klerikalfaschismus
Der Klerus musste seiner besondersten Klientel beistehen, "der militärischen Aristokratie", deren Erzieher er ohnehin schon war [Alain 1921, 49)].
Im 1. Weltkrieg ging die kriegerische Aggression noch von einer ähnlich gearteten Aristokratie aus, im 2. Weltkrieg und im Ukrainekrieg aber bereits von Nachfolgern dieser untergegangenen Klasse, so dass die Militarisierung der Kirche keine große Rolle mehr spielte. Vielleicht soll aber auch der Ukrainekrieg Russlands diese alte Ordnung wiederaufrichten ...
"Die Idee, der Mensch sei nicht gut und verdiene folglich nur das härteste Unglück" [Alain 1921, 49)], kann eigentlich nur den Ausdünstungen der Religion entstammen und dem Glauben an dunkle magische Mächte.
Theologie befasse sich genauso wie Politik mit der Beeinflussung der "Menschenmasse", also der Gesellschaft [Alain 1921, 48)].
Dieser “theologische Geist” beurteilt "die Dinge nach den Menschen" und hauptsächlich über die "Praxis des Befehlens" [Alain 1921, 48)] (- des magischen Befehlens!) ...
Der Befehl ist am erfolgreichsten, wenn er ungeprüft eine möglichst große Menschenmasse in Bewegung setzen kann.
Damit ist das Syndrom des Klerikalfaschismus definiert: er wird angetrieben und treibt an mit Hilfe des irrationalen Denkens, der Anfeindung und der Intrige.
Die wirkliche gesellschaftliche Praxis sei dagegen eine handwerkliche: die Analyse der Dinge und die Arbeit mit ihnen. Dem theologischen oder politischen Geist, angetrieben von leeren Versprechungen und Ehrgeiz, fehle hingegen diese Hauptsache - das materielle Objekt. [Alain 1921, 48)]
Die Mentalität des Herrschens
Wenn schon das Herrentum eine deutliche Form der Missachtung des Menschen war, dann gilt das noch viel mehr für das Kommandowesen des Militarismus.
Auch gilt der Verdacht, dass Kriege jeder Art (also auch Wirtschaftskriege) den Interessen jeder Art von Eliten oder "Gewalten" eines Staates dienen.
"Der Ehrgeizige betrachtet die Gewalten als Zweck ..." und erlebt seine Handlungsweisen (hündische Unterwerfung und Nachahmung) als "Ausdruck guten Benehmens" [Alain 1921, 34)].
Was hast du gelernt im Kriege?: "Man muß energisch die Gewalten aller Art reduzieren - welche zweitrangigen Nachteile auch eintreten mögen -, wenn man den Frieden erhalten will." [Alain 1921, 36)]
Den Eliten muss man misstrauen, weil ihnen die auf sie zugeschnittene Kriegsordnungen "zu viele Vorteile" verschaffen.
Alain versäumt es in dieser Zeit aber noch, den direkten Zusammenhang mit Technologie und Technokratie herzustellen.
An anderer Stelle führt er allerdings aus, dass diese schon eher zur Domäne des Proletariats und nicht etwa der Elite geworden waren.
"Ein Hauptmann ist nicht sehr bedeutend, aber in den Kriegsjahren gab es mehr Distanz zwischen einem einfachen Soldaten und einem Hauptmann als ehemals zwischen einem Leibeigenen und einem Lehnsherren." [Alain 1921, 42)]
Den Krieg lobten Offiziere, "die aus der Sklavenarbeit Nutzen zogen".
Und der Rückgriff der Moderne auf die breite Bevölkerung für den Militärdienst beförderte dieselbe zurück in die Zeiten der Sklaverei.
Der Geist des 1. Weltkriegs war der Krieg der adeligen Offiziere gegen die eigenen Soldaten.
Der Geist des 2. Weltkriegs und des Ukrainekrieges war der Krieg der Militärs gegen die Bevölkerung.
Es geht im Krieg vor allem um die "absolute Macht" zu jeglicher Befehlsgewalt, die auch heutigentags wieder in praktisch jeder Nachrichtensendung auf der Agenda steht.
Die Befehlskette soll aufrecht erhalten werden, gerade die gegen jegliche Vernunft.
Befehlsgewalt bedeutet, "nach dem Wunsch der Mächtigen" zu radikalem Aktivismus aufzustacheln und diesen selbstmörderischen Aktivismus Andere ausführen zu lassen.
"Der furchtbare, jetzt vollständig enthüllte Gesellschaftsvertrag" war die Befehlskette geworden, die "jeden in seinen Handlungen zum Schlimmsten" zwingt. [Alain 1921, 58)]
Der Kommandant solle verflucht werden von denen, die er in den Tod schickt [Alain 1921, 87)]. Gleichermaßen natürlich auch der Staatenlenker oder Parteiführer.
Vielleicht werden sie aber über die Folgen ihres Willens getäuscht: "Denn die besser informierten Mittelsmänner haben keine Befehlsgewalt, und der Befehlende weiß überhaupt nicht, was er tut." [Alain 1921, 87)]
Wäre es nicht teuflisch, wenn dieser gar nichts von den Folgen wissen wollte?
Dummheit als Privileg
Anhand der Evidenz könnte man annehmen, dass nur Dumme herrschen wollen, weil ihre Herrschaft so überflüssig wie ein Kropf ist.
Doch Alains Text führt zu einer anderen ernsthaften Hypothese. Er vermutet nämlich, dass Dummheit erst aus dem Dünkel der Herrschaft entsteht.
Sklaverei führe zu "erzwungener Freundschaft", während die "frei gewählte Freundschaft" nur kurzlebig sei.
Der Sklave sei auch gezwungen, erfinderisch zu sein angesichts seiner nur beschränkten Mittel, und, "seine Leidenschaften zu mäßigen".
All das fördere die Weisheit.
Doch "jeder wird ein Tor sein, sobald er König ist".
[Alain 1921, 33)]
Eigentliche Triebkraft systemischer Dummheit wird der besondere Aspekt "wichtigtuerischer Bosheit", die erst die Gewalten hervorbringe, wo vorher Funktionen waren [Alain 1921, 29)].
Im Kriege kann dieser Charakterzug von der aus kurzsichtiger Rationalität entstandenen Klasse der Befehlsempfänger profitieren.
Man werde nicht als Dummkopf geboren, sondern werde es erst durch eine Wichtigtuerei, die sich "mit allem aufplustert".
Die Macht brauche die Kommandostrukturen des Krieges so dringend, dass sie sogar die "technischen Errungenschaften, die ... den Sieg zu erringen trachten", zurückweise.
Im Ersten Weltkrieg war die Offizierslaufbahn an keine Fähigkeiten geknüpft, sondern ein Privileg. Für die Privilegierten wurde der Krieg “der edle Beruf”. [Alain 1921, 41)]
Bourgeoises Denken bemüht sich immerhin, zu gefallen, sei aber nicht anständig.
Der Bourgeois bewege sich "in den Grenzen der Vergnügungskunst" und der "unwidersprochenen Themen". [Alain 1921, 37)]
Der vielleicht vernichtendste Ausspruch Alains ist jener zum Bourgeois: "Vielleicht zielte ich zu hoch, als ich in solch einem Kopf Ideen voraussetzte."
So waren die Objekte der Politik, das sogenannte Volk, "gezwungen, die Übergriffe der Macht durch ihre geheime, beständige energische Negation zu begrenzen" [Alain 1921, 68)].
Wenn diese Aussage auch recht dunkel bleibt, wird aus diesen Textpassagen doch die völlige und willkürliche Kappung der eigentlich notwendigen Beziehungen zwischen der 'Macht der Gegebenheiten' und der 'Macht der politischen Partei' deutlich.
Allerdings führt auch der Autor selbst so eine Trennung herbei, indem er womöglich die Realität des feindlichen Angriffskrieges verdrängt.
--> Fortsetzung des Textes --->
© Stephan Theodor Hahn, Bad Breisig, am 16.4.2025