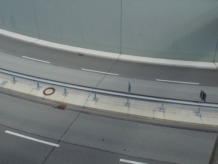Die Mentalität des Militarismus
Alain's “Psychologie des Krieges” von 1921
Systemgewordene Mentalität
Junge Männer wurden "der Hierarchie, dem Hohn, der Herrschaft der am meisten Verderbten" ausgeliefert [Alain 1921, 4)]. Diese Art der Ausbildung hat utilitaristisch gesehen den Krieg als Produktionsziel.
Nur die "schwachen Geister" rechneten "mit Freundschaft und Begeisterung" in der Armee und ähnlichen Organisationen. Statt dessen müsse der jugendliche Geist "durch die Aktion eines vollkommenen Systems komprimiert und schikaniert" werden, bis "kein anderer Ausbruch möglich ist als gegen den Feind". [Alain 1921, 5)]
Es ist ein Staatsapparat, der den Zwang zum Kriegführen herstellen soll; so wird es schon bei Stammeskriegen gewesen sein ...
Die kriegerischen Ereignisse dürften stets die Empfindung entstehen lassen, "daß der Kriegsgeist nicht mit Gewinn-, Rivalitäts- oder Streitsucht verwechselt werden darf", selbst wenn diese Leidenschaften die Gesellschaft beherrschen.
Er entsteht durchaus nicht in individuellen Gemütern als ein "durch Interessen, Zornesausbrüche oder sogar Leidenschaften hervorgerufener Konflikt", sondern der Kriegsgeist ist das Produkt von totalitären Strukturen und Institutionen. [Alain 1921, 61)]
Wenn nicht der Krieg, sondern der Frieden institutionalisiert würde, wären nur bei der Verteidigung und gegenseitiger Hilfe Kriegshandlungen erlaubt.
Angriff als System
Ich frage mich, ob man bei offenen Kriegen nicht auch von Selbsterhaltungstrieb reden muss anstatt von einer Doktrin des "universellen Egoismus" [Alain 1921, 19)], die den Krieg verursacht und durch welche Verteidigung gleichbedeutend mit Angriff wird.
Ein wichtiges Kennzeichen des Angreifers ist aber, dass nur er einen Vorteil daraus gewinnen will, den Anderen zu opfern.
Der Angegriffene will nur in den ursprünglichen Zustand zurückkehren.
Die strategischen Interessen von Nationen seien wahrscheinlich nicht die Ursache von Kriegen, weil Interessenkonflikte gewöhnlich durch einen juristischen Vergleich beigelegt werden können.
Es gehe um von Tyrannen gelenkte Leidenschaften.
Besonders ist klarzustellen, dass es gerade bei Weltkriegen mit ihren komplexen Beziehungen niemals um einen Interessenkonflikt gehen kann, sondern nur darum, dass sich die Neigung oder Leidenschaft eines Volkes dem einen oder anderen Staatenblock zuwenden soll.
Man muss auch einwenden, dass strategische Interessen eigentlich nur dem Namen nach so heißen, aber in Wirklichkeit die irrationale Leidenschaft einer tyrannischen Minderheit sind.
Wie Alain ausführt, wird die Revolte durch bewusste Provokation herbeigeführt [Alain 1921, 24)]. Das "Bewusstsein" der Provokation kann auch darin bestehen, die später Revoltierenden zu berauben oder auf tausend andere Arten zu schädigen.
Dieser Autor ist so intelligent, darauf hinzuweisen, dass auch die Herrschaft oder Regierung selbst nicht selten als Provokation ausgeübt wird.
Die Revolte (oder Verteidigung) kann dann als Vorwand für weiteren Staatsterror oder einen militärischen Angriff dienen.
Frieden schaffen
Das Ziel des organisierten Krieges ist der Tod von Menschen, folglich ist Krieg ein Verbrechen.
Nur in einem der Artikel ('propos') von E. A. Chartier wird ausgesprochen, dass ein Krieg mit Entschlossenheit, also auch mit militärischer Gewalt beendet werden muss - das spricht nicht für die Philosophie Alain's ...
Dieser Autor ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Argumente der Pazifisten im Falle einer kriegerischen Aggression oder einer übermächtigen staatlichen Gewalt an Überzeugungskraft einbüßen.
In Wirklichkeit geht es beim Pazifismus nur um den notwendigen Widerstand "gegen die Kriegsidee".
Widerstand gegen die Verteidigungsfähigkeit würde hingegen nur die 'Kriegsidee' anderer anregen.
Es besteht eine enge Verwandtschaft oder Übereinstimmung der Konzepte von Rechtsordnung und Friedensordnung, denn repressive und kriegerische Gewalt schaffen kein Recht, sondern nur eine Gewaltordnung.
Gewalt muss daher als Revolte und kann nicht als Ordnungskraft angesehen werden.
Doch jeder wolle Gewalt "mit Gewalt bestrafen" ... [Alain 1921]
Nein - das ist gar nicht die Priorität, jeder sollte weitere Gewalt mit Gewalt verhindern!
Erst wenn man zu dieser Intention gelangt ist, darf man natürlich die Frage stellen: Frieden durch Abrüstung oder durch Hochrüstung?
Die Eskalation von Konflikten zwischen Populationen und Staaten wird durch das Fehlen eines innerhalb der Menschheit allgemeinverbindlichen Gesetzes oder internationalen Rechtes erleichtert [Fromm 1977, Kap.9].
Eigentlich geht es nur um die Anerkennung universalen Rechtes.
Die Überwindung des nationalen Denkens scheint aber vielen Menschen unmöglich zu sein. Die Ursache dafür ist, dass der Staat, die Nation oder die Partei als Schutzmächte angesehen werden. Wenn aber ein Staat oder eine andere Organisation immer weiter aufrüstet, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie zum Aggressor werden.
Dagegen würde ein supranationales Gewaltmonopol helfen.
Im 19. Jh. glaubte man, dass die Stärke der einzelnen Nationen Garant der europäischen Friedensordnung sei.
Durchdrungen vom Geist der Nation, die doch eigentlich die Ursache von Konflikten ist, können sich deren Lenker dann zu Friedensverhandlungen aufschwingen.
Schon Zar Nikolaus II. initiierte die Haager Friedenskonferenzen (1899, 1907, 1914) [Morris 2013, Kap.4].
Der Mensch ist nicht nur in die Grenzen einer Nation integriert, sondern auch in andere Sphären, darunter das Denken der gesamten Menschheit [Alain 1921, 92)].
Krieg entsteht dadurch, dass das Denken in nationale oder parteiische Grenzen gezwängt wird.
Wenn man Ideologien der Idee der Menschheit unterordnet, gewinnen sie an Bedeutung. Stämme seien "unwissend, grausam und machtlos" [Alain 1921, 92)].
Alain glaubte, Kriege werden nicht aus "niedrigem Diebeskalkül" entfacht, sondern aus "verletzter Ehre". Er führte sie sogar auf eine "auf ausschließlich moralische Macht gegründete Regierungskunst" zurück - wie lächerlich! [Alain 1921, 17)]
Diese Regierungskunst bestand nämlich in der infamen Taktik, das Ehrgefühl anzustacheln.
Es hat in der jüngsten Geschichte aber sogar Beispiele gegeben, dass Regierungen und andere Parteien zur Begründung von Krieg oder Terror selbst die allerniedrigsten Beweggründe ins Feld führten und mit Ehrgefühl gleichsetzten.
Das Ehrgefühl sei der "Motor" des Krieges, obgleich dieser von Gier und Barbarei angezettelt wurde [Alain 1921, 17)]. Um einen Krieg zu beenden, käme dann nur die unehrenhafte Kollaboration in Frage ...
"Verneine entschlossen, ohne jedes Zugeständnis, den Krieg; bevor du ihn mitmachst, wenn du ihn mitmachst und nachdem du ihn mitgemacht hast. Denn du hast begriffen, dass der Krieg von der Zustimmung lebt. Beginne damit, ihn nicht zu füttern."
Diese Haltung kann man sich allerdings nur in einer Zivilgesellschaft mit einer starken Verteidigung leisten.
In einer Zivilgesellschaft sind der Militarismus und das Verbrechen des Krieges nicht zur Staatsdoktrin erhoben. Es sei denn, sie macht den Wirtschaftskrieg zu ihrer Staatsdoktrin.
Quellen:
# Alain [Emile Auguste Chartier]: Mars oder die Psychologie des Krieges (übersetzt von Heinz Abosch). Frankfurt/M., 1985 (Originalausgabe 1921).
-- 2] Der nackte Krieg
-- 4] Kampftiere
-- 5] Die Schmiede
-- 10] Spielregeln
-- 13] Das Medusenhaupt
-- 17] Von der Ehre
-- 19] Vom universellen Egoismus
-- 20] Von den Leidenschaften
-- 22] Von der Gewalt
-- 24] Von der Revolte
-- 29] Die Wichtigtuer
-- 33] Die Macht
-- 34] Vom Ehrgeiz
-- 36] Was hast du gelernt?
-- 37] Vom Anstand
-- 39] Von den Klassen
-- 40] Die Situation des Proletariats
-- 41] Der edle Beruf
-- 42] Von der Demokratie
-- 48] Der theologische Geist
-- 49] Herr Kriegspfarrer
-- 58] Von dressierten Hunden
-- 61] Der Kriegsgeist
-- 68] Zweimal Politik
-- 79] Herkules
-- 89] Anhand der Ursachen
-- 90] Der Geist
-- 92] Die Menschheit
# Erich Fromm: Anatomie der menschlichen Destruktivität. Reinbek, 1977 (Taschenbuch; amerikanische Originalausgabe 1973).
-- Kap.9: Die gutartige Aggression
# Ian Morris: Krieg - Wozu er gut ist. Frankfurt/ New York, 2013.
-- Kap.4: Der Fünfhundertjährige Krieg - Europa erobert (beinahe) die Welt, 1415 bis 1914
© Stephan Theodor Hahn, Bad Breisig, am 17.4.2025